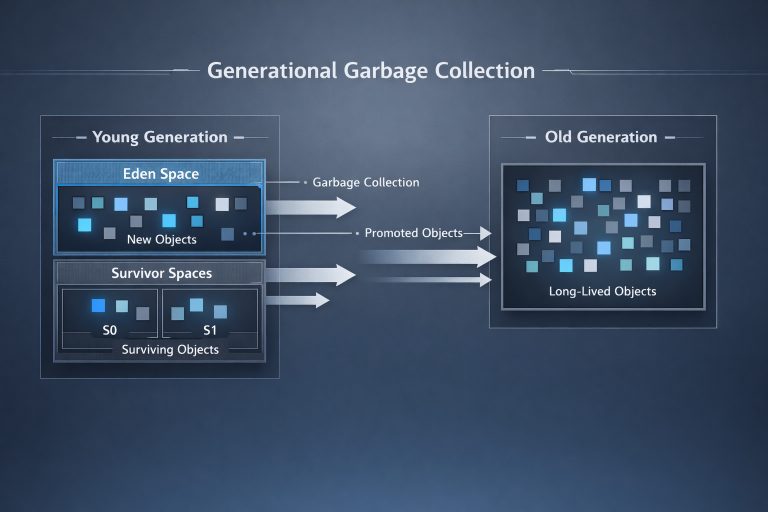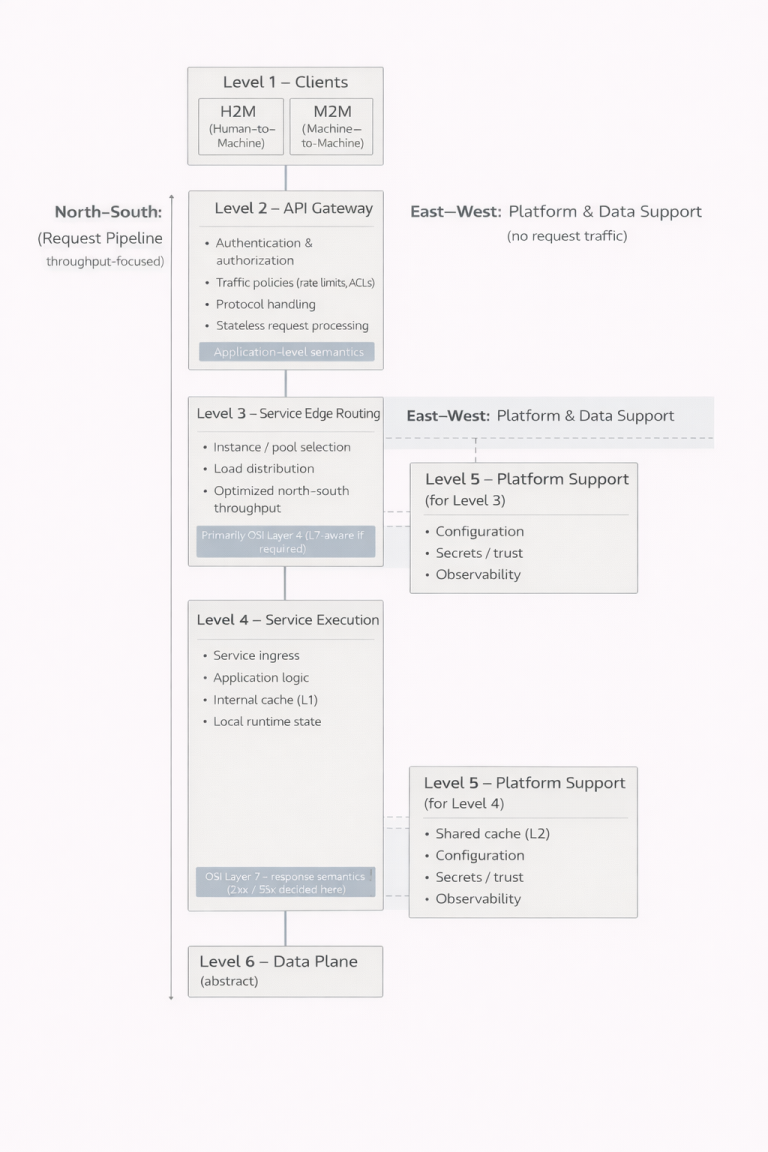UX ist kaputt – und niemand will es zugeben
Customer Experience ist zu einem der zentralen Diskurse moderner Organisationen geworden. Sie erscheint in Strategien, Roadmaps, Kennzahlensystemen und Managementpräsentationen. Dennoch wird nur selten innegehalten, um zu fragen, was Customer Experience heute tatsächlich bedeutet – oder ob sie überhaupt noch der Realität entspricht, in der Menschen leben, handeln und Entscheidungen treffen.
Ich vertrete die These, dass das Fundament der Customer Experience – und insbesondere des UX-Denkens – beschädigt ist. Nicht deshalb, weil einzelne Designlösungen schlecht wären, sondern weil das gesamte konzeptionelle Gerüst auf einer Welt beruht, die so nicht mehr existiert. Und genau das ist etwas, das nur wenige bereit sind anzuerkennen.
Es ist wichtig zu präzisieren, was in diesem Zusammenhang mit „kaputt“ gemeint ist. Customer Experience ist nicht in dem Sinne defekt, dass sie gar nicht mehr funktioniert. Sie produziert weiterhin Ergebnisse, Berichte und Entscheidungen. Sie ist jedoch insofern beschädigt, als ihre grundlegenden Annahmen über Menschen, Kontexte und Handlungen veraltet sind. Das Modell funktioniert technisch, aber es erklärt eine Realität, die es so nicht mehr gibt.
In diesem Sinne ist das Problem nicht bloß, dass Customer Experience im umgangssprachlichen Sinne „nicht mehr funktioniert“. Was wir erleben, ist ein tiefer liegendes Phänomen: ein konzeptioneller Zusammenbruch, eine epistemische Krise. Wir wissen nicht mehr mit Sicherheit, worauf sich Customer Experience unter heutigen Bedingungen eigentlich bezieht – und messen sie dennoch weiter, als wäre ihre Bedeutung selbstverständlich.
Eine epistemische Krise bedeutet nicht, dass kein Wissen mehr erzeugt wird. Im Gegenteil: Es werden mehr Daten produziert als je zuvor. Die Krise besteht darin, dass wir nicht mehr wissen, was diese Daten eigentlich repräsentieren. Die Messung geht weiter, aber ihr Gegenstand ist unscharf geworden.
Customer Experience ist zur Annahme geworden – nicht mehr zur Frage
Ursprünglich war Customer Experience ein forschungsgetriebener Ausgangspunkt. Sie beruhte auf Unsicherheit: Wir wissen nicht, wie eine Person einen Service erlebt, also müssen wir beobachten, zuhören, messen und testen. Customer Experience war eine Frage, keine Antwort.
Im Laufe der Zeit hat sich diese Frage in eine Annahme verwandelt. Customer Experience wird nicht mehr problematisiert, sondern als gegeben vorausgesetzt. Metriken berichten ihren Zustand. Dashboards zeigen ihre Richtung an. Abweichungen werden als Randfälle interpretiert – nicht als Hinweise darauf, dass das gesamte Modell möglicherweise unzureichend ist.
Sobald Customer Experience zur Annahme wird, hört sie auf, Gegenstand von Erkenntnis zu sein. Sie wird zur Norm. Und Normen stellen keine Fragen – sie lenken Verhalten.
Der Customer-Experience-Diskurs ist in seinen eigenen Begriffen gefangen
Die Diskussion über Customer Experience kreist weiterhin um dieselben Begriffe: Reibungslosigkeit, Einfachheit, Friktion, Conversion, Engagement. Diese Konzepte sind in einem Umfeld entstanden, in dem Dienstleistungen linear waren, Nutzungssituationen klar begrenzt und die Reizdichte gering war.
Heute wird kaum noch hinterfragt, ob diese Begriffe überhaupt noch ausreichen. Sie gelten als selbstverständlich. Wenn das begriffliche Vokabular stagniert, stagniert auch das Denken. Customer Experience beginnt, sich selbst zu erklären.
Infolgedessen wird alles Neue in ein altes Raster gezwungen, anstatt das Raster selbst zu hinterfragen. Customer Experience entwickelt sich nicht weiter – sie wiederholt sich.
Customer Experience misst, was sie messen kann
Eines der zentralen Probleme des Customer-Experience-Denkens ist seine Tendenz, Messbarkeit mit Bedeutung gleichzusetzen. Was sich leicht operationalisieren lässt, erhält überproportionales Gewicht. Klicks, Pfade, Conversions und Latenzen werden zu Stellvertretern für Erfahrung – nicht, weil sie diese erklären, sondern weil sie verfügbar sind.
Dies ist kein Versagen der Messung an sich. Das Problem entsteht, wenn Metriken aufhören, Werkzeuge zu sein, und beginnen, Realität zu definieren. In diesem Moment versucht Customer Experience nicht mehr, den Menschen zu verstehen, sondern optimiert das System aus seiner eigenen Logik heraus. Erfahrung wird auf das reduziert, was in das Modell passt.
In diesem Sinne ist Customer Experience nicht bloß ein schlecht gemessenes Phänomen, sondern eine normative Struktur. Sie legt fest, welche Art von Erfahrung als akzeptabel gilt.
An dieser Stelle sollte man das Problem klar benennen: Häufig messen wir nicht die Kundenerfahrung, sondern die Fähigkeit des Kunden, schlechte organisatorische Prozesse zu tolerieren. Der Net Promoter Score misst selten Zufriedenheit – geschweige denn eine bedeutsame Erfahrung. Meist zeigt er lediglich an, ob der Kunde noch genug Energie hatte, sich zu beschweren. NPS ist ein Überlebensindikator, kein Maß für Aufblühen.
Das macht Metriken nicht wertlos, aber es macht sie gefährlich, wenn sie als Wahrheit über Erfahrung interpretiert werden. Wenn Toleranz mit Erfahrung verwechselt wird, belohnt sich das System selbst dafür, dass der Kunde noch nicht gegangen ist.
Customer Experience toleriert keine Unsicherheit – obwohl Realität darauf beruht
Frühe Ansätze der Customer Experience erkannten Unsicherheit an. Menschen galten als teilweise unvorhersehbar und mussten daher beobachtet werden. Das heutige Customer-Experience-Denken hingegen versucht, Unsicherheit zu minimieren – durch Standardisierung, Generalisierung und Abstraktion.
Unsicherheit verschwindet dadurch nicht, sie wird lediglich unsichtbar. Wenn Customer-Experience-Modelle als Wahrheiten präsentiert werden, gelten Abweichungen als Störungen. Menschliches Verhalten erscheint dann fehlerhaft, wenn es nicht dem Modell entspricht. Damit kehrt sich das ursprüngliche Verhältnis um: Das Modell wird zum Maßstab der Realität, nicht umgekehrt.
Aus wissenschaftlicher Sicht handelt es sich hierbei um einen Kategorienfehler. In der Praxis bedeutet es, dass sich Menschen an ein Modell anpassen müssen, das ursprünglich für sie gedacht war.
Die Sprache der Customer Experience ist flüssig – aber nicht mehr erklärend
Der heutige Diskurs über Customer Experience ist sprachlich äußerst ausgefeilt. Er bedient sich überzeugender Begriffe, visueller Darstellungen und Narrative, die den Eindruck tiefen Verständnisses erzeugen. Gerade diese sprachliche Glätte erschwert jedoch die kritische Auseinandersetzung.
Wenn Sprache zu gut funktioniert, verdeckt sie ihre eigenen Grenzen. Customer Experience wird behandelt, als sei sie ein universelles Phänomen, obwohl sie in Wahrheit ein historisches Konstrukt ist – geprägt durch spezifische technologische, ökonomische und kulturelle Bedingungen.
Dass etwas plausibel klingt, bedeutet nicht, dass es konzeptionell tragfähig ist.
Warum dies nicht früher hinterfragt wurde
Es liegt nahe zu fragen, warum die strukturellen Probleme des Customer-Experience-Denkens nicht früher erkannt wurden. Die Antwort liegt weder in Verschwörung noch in Inkompetenz, sondern im Erfolg. Customer Experience hat lange Zeit gut genug funktioniert.
Genau das macht die Situation problematisch. Wenn ein Modell ausreichend funktioniert, werden seine Grenzen erst sichtbar, wenn sich die Umwelt schneller verändert, als das Modell sich anpassen kann. Dieser Punkt ist inzwischen erreicht. Die grundlegenden Annahmen der Customer Experience sind nicht plötzlich zusammengebrochen – sie haben sich schleichend von der Realität entfernt.
Diese Drift lässt sich nicht durch die Verfeinerung alter Modelle beheben. Sie erfordert die Anerkennung, dass bereits der Ausgangspunkt fehlerhaft ist.
Der Nutzer ist nicht mehr der Mensch, auf den sich Customer Experience ursprünglich bezog
Zeitgenössische Customer-Experience-Modelle basieren auf der Annahme eines rationalen, relativ stabilen Akteurs, der innerhalb eines Services Entscheidungen trifft. In Wirklichkeit agieren Menschen unter permanenter Reizüberflutung, in überlappenden Kontexten und unter erheblicher kognitiver Belastung.
Ein Mensch begegnet einem Service nicht isoliert. Er ist kein „User“ im ursprünglichen Sinne. Er ist ein dynamisches Zustandsgefüge, dessen Erleben durch körperliche Verfassung, Umwelt, Zeitdruck, Vorerfahrungen, soziale Signale und viele weitere Faktoren geprägt wird, die kein einzelnes Interface kontrollieren kann.
Dennoch behandeln Customer-Experience-Modelle den Menschen weiterhin so, als wäre er ein internes Systemelement. Diese Vereinfachung ist nicht neutral – sie prägt Messung, Interpretation und letztlich Entscheidungen.
Ein Mensch ist kein User. Der User ist eine technische Abstraktion, geschaffen zur Vereinfachung von Systemdesign. Er ist kein anthropologischer Befund. Menschliche Entscheidungen werden stärker durch Wachheit, Blutzucker, Stress und Umgebung beeinflusst als durch Buttonfarben oder Layouts.
Zeitgenössisches Customer-Experience-Denken blendet dieses Ganze aus – nicht weil es unbekannt wäre, sondern weil es sich nicht leicht modellieren lässt. Was sich nicht messen lässt, wird systematisch unsichtbar gemacht.
Umwelt, Kontext und Reizdichte haben sich verändert – die Modelle nicht
In den letzten zehn Jahren hat sich die Welt radikaler verändert, als viele Customer-Experience-Modelle anerkennen wollen. Die Reizdichte ist gestiegen, Entscheidungsprozesse sind fragmentiert, technologische Vermittler haben sich vervielfacht. Dennoch wird Customer Experience oft noch mit derselben Logik gemessen wie zuvor.
Der Service wird weiterhin als isoliertes Ereignis betrachtet, obwohl er in Wirklichkeit nur eines von vielen Signalen ist. Erfahrung entsteht nicht im Service selbst, sondern im Gesamtzustand des Menschen. Wird dies ignoriert, messen Kennzahlen nicht mehr menschliche Realität, sondern Systembequemlichkeit.
An diesem Punkt beschreibt Customer Experience nicht mehr Erfahrung, sondern die Annahme des Systems darüber, wie Erfahrung zu sein hat.
Das Ende der linearen Welt
Die Krise der Customer Experience ist kein Ergebnis von Nachlässigkeit, sondern eines historischen Übergangs. Die zentralen Modelle entstanden in einer grundsätzlich linearen Welt. Dienstleistungen hatten einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Der Nutzer betrat ein System, erledigte eine Aufgabe und verließ es. Erfahrung war ein Pfad.
Diese Welt existiert nicht mehr. Die heutige digitale Realität ist kein Pfad, sondern ein Feld. Sie ist permanent aktiv, überlappend und unterbrochen. Menschen „nutzen“ keine Services mehr – sie befinden sich gleichzeitig im Einfluss mehrerer Systeme. Erfahrung entsteht nicht aus einer einzelnen Interaktion, sondern aus einem dynamischen Zustand, den lineare Modelle nicht erfassen können.
Alte Modelle auf diese Realität anzuwenden führt zwangsläufig zu Verzerrungen. Das macht sie nicht moralisch falsch, aber konzeptionell unzureichend.
Customer Experience lebt in einer Welt, die es nicht mehr gibt
Viele heutige Customer-Experience-Praktiken sind implizit in einer Vergangenheit verankert – in einer Welt fokussierter Nutzer, begrenzter Kanäle und klarer Interaktionsphasen.
Diese Welt ist verschwunden. Doch die Modelle bestehen fort. Sie erzeugen eine Illusion von Kontrolle in einer Situation, in der die Realität komplexer geworden ist, als die Modelle zulassen. Dadurch entsteht ein Gefühl von Sicherheit, während echtes Verständnis schwindet.
In diesem Sinne ist Customer Experience nicht nur veraltet. Sie ist strukturell unehrlich gegenüber der Realität, die sie zu beschreiben vorgibt.
Dies ist nicht die Schuld einzelner Fachleute
Es ist wichtig, dies klarzustellen: Das Problem liegt nicht bei einzelnen Designerinnen, Forschern oder Entwicklern. Die meisten handeln nach bestem Wissen und Gewissen innerhalb der ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeuge und Konzepte.
Das Problem ist strukturell. Es entsteht dort, wo ganze Professionen, Ausbildungssysteme und Geschäftslogiken auf denselben Grundannahmen beruhen – und wo niemand einen echten Anreiz hat, diese zu hinterfragen. Wenn Metriken, Karrierewege und Organisationen auf derselben Logik aufbauen, bleibt kritische Reflexion zwangsläufig marginal.
Das Problem ist strukturell, nicht operativ
Customer Experience lässt sich nicht durch mehr Tests, feinere Metriken oder aktualisierte Designsysteme reparieren. Das sind operative Antworten auf ein strukturelles Problem.
Ein strukturelles Problem erfordert eine strukturelle Untersuchung. Erstens müssen wir klären, was wir überhaupt unter Customer Experience verstehen. Zweitens müssen wir die Annahmen über menschliches Verhalten identifizieren, die in unseren Modellen verankert sind. Drittens müssen wir prüfen, inwieweit diese Annahmen der heutigen Realität entsprechen. Ohne diese Auseinandersetzung bleibt Customer Experience eine polierte Erzählung über eine Welt, die es nicht mehr gibt.
Wenn Customer Experience ehrlich wäre, würde sie hier beginnen
Ein ehrlicher Zugang zu Customer Experience würde nicht mit Lösungen beginnen, sondern mit Zweifel. Er würde anerkennen, dass bestehende Modelle partiell, historisch bedingt und begrenzt sind. Er würde akzeptieren, dass nicht alles Bedeutungsvolle messbar ist – und dass Messung selbst formt, was wir für real halten.
Diese Situation ist keine Sackgasse. Eine epistemische Krise ist auch eine Chance. Sie zwingt uns, jene Fragen erneut zu stellen, die aufgegeben wurden, als Customer Experience institutionalisiert wurde. Was erlebt ein Mensch? Wo entsteht Erfahrung? Unter welchen Bedingungen lässt sie sich überhaupt verstehen?
Hoffnung entsteht nicht durch neue Metriken oder bessere Werkzeuge, sondern durch Ehrlichkeit gegenüber dem, was wir noch nicht wissen.
Dieser Text versucht nicht, Customer Experience zu reparieren. Sein Ziel ist es, eine berechtigte Frage zu stellen: Entsprechen die heutigen Customer-Experience-Modelle noch der Welt, in der Menschen tatsächlich leben?
Auf diese Frage werde ich im nächsten Beitrag zurückkommen.